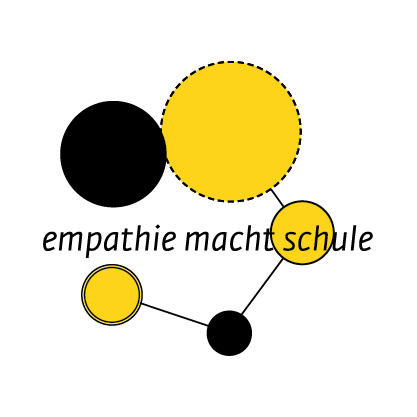Fast zeitgleich mit dem Start von Empathie macht Schule trat Corona auf. Und nicht nur die Schulwelt stand auf dem Kopf. Mona Kino hat für Empathie macht Schule nachgefragt: Wie sinnvoll ist es, eine Studie unter diesen Bedingungen zu starten, und geht das überhaupt?
Empathie macht Schule: Du bist Doktorand des Schul- und Forschungsprojekts Empathie macht Schule, magst Du mir kurz erläutern, wie ihr die wissenschaftlichen Daten erhebt?
Lukas Herrmann: Zunächst mischen wir das Schulpersonal von drei Berliner Grundschulen. Diese werden dann in zwei Kohorten aufgeteilt. Die erste Kohorte wird eineinhalb Jahre in sechs Modulen in Beziehungskompetenz, Achtsamkeit und Empathie geschult, bekommt dann ein weiteres Jahr Supervision. Im vierten Jahr beginnt sie damit, sich eigenständig gegenseitig kollegiale Reflexion in dem Stil zu geben, wie sie es gelernt hat. Mit Körper- und Achtsamkeitsübungen zu Beginn des Treffens, einem dialogischen Gesprächsteil, der vier Punkte der Beziehungskompetenz berücksichtigt und Abschlussübungen am Ende des Treffens. Die zweite Kohorte durchläuft zeitversetzt das gleiche Programm und endet eineinhalb Jahre später. Nachdem die zweite Kohorte das volle Programm durchlaufen hat, erheben wir einige Monate später die letzten Daten. Außerdem gibt es drei Vergleichsschulen, die kein Empathietraining durchlaufen und deren Daten wir ebenfalls erheben.
Empathie macht Schule: Welche Auswirkungen hatte Corona auf die Forschungsarbeit?
Lukas Herrmann: Bevor es Corona gab, wollten wir herausfinden, wirkt das Empathietraining oder wirkt es nicht? Dafür muss man vergleichen, wie es vorher im Schulalltag war und wie es nachher ist. Wie geht man in Schulen miteinander um, die das Training machen und wie in Schulen, die es nicht machen? Auf diese Weise können wir recht gut sicherstellen, dass die gemessenen Unterschiede und Veränderungen, wirklich etwas mit dem Training zu tun haben. Dafür sollte es aber wenig andere „Störfaktoren“ geben. Und Corona ist leider ein riesiger Störfaktor.
Empathie macht Schule: Das heißt, Corona stand in Konkurrenz zu Empathie macht Schule?
Lukas Herrmann: Ja, Corona hat ja alles an Grundbedingungen in der der Schule durcheinander geworfen. Das, was in den letzten eineinhalb Jahren im Bildungssystem stattgefunden hat, ist ja der größte Umbruch, die größte Krise seit dessen Bestehen oder dem zweiten Weltkrieg. Das heißt, es war eine schwierige Ausgangssituation, in der sich alles um 180 Grad gedreht hat und durcheinander gewirbelt wurde. Aber wir haben das Beste daraus gemacht, um trotzdem etwas darüber zu lernen. Denn wenn man es aus einer anderen Perspektive betrachtet, hat sich für uns Wissenschaftler die Möglichkeit ergeben, zu untersuchen: Was genau macht denn Corona innerhalb des Bildungssystems? Von daher ist es rückblickend gesehen, doch ein ziemlich guter Zeitpunkt gewesen, weil ich schon vor Corona mit den Schulleitungen Interviews geführt hatte. Und als dann Corona kam, habe ich wieder Interviews mit Ihnen geführt. Und so konnte man sehen, was sich da genau abgespielt hat.
Empathie macht Schule: Was hat Corona verändert?
Lukas Herrmann: Mir wurden einige Dinge erzählt, die sich in allen Schulen gleichermaßen gezeigt haben. Dazu gehört natürlich der hohe Stresslevel, oder dass die Schüler*innen auf einmal gesagt haben, wie gerne sie in die Schule gehen. Ein weiterer wichtiger Fund aus der Forschung ist, dass die kleinen Klassengrößen während Corona die Beziehungen zwischen Schülern und Lehrern, sowie das Klima verbessert haben. Die Kinder sind richtig aufgeblüht und die Dynamik in den Klassen wurde besser. Viele konnten mal neue Rollen und Verhaltensweisen ausprobieren. Zum Beispiel waren solche Kinder, die die Lehrer vorher herausgefordert haben, eher ruhiger und ruhige Kinder traten in den Vordergrund. Das Abstandhalten bereitet vielen Schwierigkeiten. Bei manchen ging es soweit, dass man sich fast gar nicht mehr gegrüßt hat oder schlichtweg einsam war. Andere Veränderungen waren je nach Schule eher spezifisch. Zum Beispiel in einen Kollegium, in dem es vorher eher mal Streit gab, haben sich die Kollegen nun gegenseitig stärker unterstützt und in einer anderen Schule, die ein sehr gutes Verhältnis zu den Eltern hatte, gab es plötzlich intensive Konflikte zwischen Schule und Elternschaft.
Empathie macht Schule: Gab es denn einige Übungen vom Empathietraining, die dem Schulpersonal dabei geholfen haben, mit den Herausforderungen umzugehen?
Lukas Herrmann: Mir wurde nicht von einer bestimmten Übung berichtet, aber generell können wir schon sagen, dass alles, was hilft, den Stress zu reduzieren und in Beziehung zu bleiben, hilfreich ist. Mir wurde beispielsweise davon erzählt wie wichtig es ist, zuzuhören und nicht gleich zu reagieren, sondern erstmal auszuatmen, wenn man mit sehr verärgerten und vielleicht ängstlichen Eltern spricht. So kann man Eskalationen vermeiden und auf eine konstruktivere und empathische Weise durch diese Krise navigieren. Und auch ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass viele schwierige Verhaltensweisen wirklich aus einer inneren Not und einem „Krisenmodus“ entspringen.
Andere Aspekte des Trainings die in dieser Situation hilfreich waren, können wir den elektronischen Tagebüchern der Teilnehmenden entnehmen. Nach jedem Modul füllen die Teilnehmenden diese Tagebücher aus. Darin wird abgefragt, wie sie das letzte Modul fanden und was sie in den Schulalltag mitnehmen. Die Analyse der Antworten hat ergeben, dass die Wertschätzung, die in den Modulen stattfindet, gut tut, dass neue Erkenntnisse über ganzheitliche Zusammenhänge in der Pädagogik ein besseres Verhältnis zu den Schülerinnen mit sich bringt und dass die entstandene Verbundenheit mit anderen Pädagoginnen in den Modulen weniger Einsamkeit oder Isoliertheit im Schulalltag entstehen lässt.
Empathie macht Schule: Und weltweit, hat sich da in Sachen Empathieforschung bzw.-vermittlung in der pädagogischen Ausbildung etwas verändert?
Lukas Herrmann: Ich bin noch in einem amerikanischen Projekt involviert, dem Compassionate Systems Approach. Dieser Ansatz vereint systemisches Denken mit sozialem und emotionalem Lernen und Achtsamkeit – er widmet sich also der Beziehung zu sich selbst, zu anderen, und zur Umwelt. Und das wird nicht nur auf Klassenebene implementiert, sondern auch in der Schulverwaltung. Beispielsweise in Kanada im Bundesstaat British Columbia oder in den USA in Kalifornien verbreitet sich dieser Ansatz sehr. Auf oberster Ebene existiert auf diese Weise ein Verständnis davon, was es für eine gelingende Beziehung benötigt, so dass sich das dann bis in die Lehrerausbildung und den Unterricht auswirken kann. Durch Corona gab es also plötzlich einen Weckruf und die Möglichkeit, anders weiter zu machen also vorher. Denn gerade in einer Zeit, in der so etwas wie Corona passiert, ist es ja besonders wichtig, dass man sich positiv und mit Mitgefühl und Empathie begegnen kann – und gleichzeitig die komplexen Zusammenhänge einer Pandemie auf systemischer Ebene verstehen kann.
Empathie macht Schule: Wer war der Entscheidungsträger dafür?
Lukas Herrmann: Das ist wie überall auf der Welt, die Politik. Bei einem Compassionate Systems Workshop war ein Mann anwesend, der einen hohen Rang in der Bildungspolitik bekleidet. Dem wurde der Zusammenhang klar, dass man mit diesem Ansatz nicht nur in Schulen, sondern auch in den Behörden eine bessere Atmosphäre gestalten kann.
Empathie macht Schule: Also ohne den einen wäre es nicht möglich gewesen, dass es so an Fahrt aufgenommen hat?
Lukas Herrmann: Ja, genau. Er war an einer entscheidenden Stelle in der Verwaltung und konnte dadurch diesen Ansatz dort verankern und gut verbreiten. Und für ihn war das eine wirkliche Herzensangelegenheit. Durch Corona wurde dann vielen anderen klar, dass es so etwas wie denCompassionate Systems Approach auch in anderen Abteilungen braucht. Und so wurde er zur Galionsfigur dieses Ansatzes.
Empathie macht Schule: Wer wäre die entsprechende Galionsfigur, die man in Deutschland in einen „Empathie macht Schule“ Workshop einladen müsste?
Lukas Herrmann: In Deutschland ist es ein bisschen schwierig, wegen des Föderalismus. Obwohl Kalifornien ja auch nur ein Bundesstaat von vielen ist. Allerdings ist er so groß wie halb Deutschland. Leute zu finden, die das Projekt toll finden, ist auch nicht so sehr die Schwierigkeit. Wichtig wären Menschen mit großem gesellschaftlichen Einfluss, die das Empathietraining selbst in ihr Leben integrieren und dafür brennen, so etwas wirklich Fuß fassen zu lassen. Jemand, der die Inhalte lebt, verkörpert und ausstrahlt. Das braucht auch Mut und ist sicherlich nicht immer bequem. Ob man etwas verändert, merkt man ja auch an dem Widerstand, den man erst mal erntet. Denn dass Empathie wichtig ist – da stimmen alle zu und denken insgeheim: „Ich bin ja schon empathisch“. Aber was es für einen Einsatz benötigt, um die Strukturen zu schaffen, damit in Schulen wirklich empathischere Beziehungen stattfinden – das ist glaube ich wenigen klar.
Empathie macht Schule: Danke für dieses Gespräch.