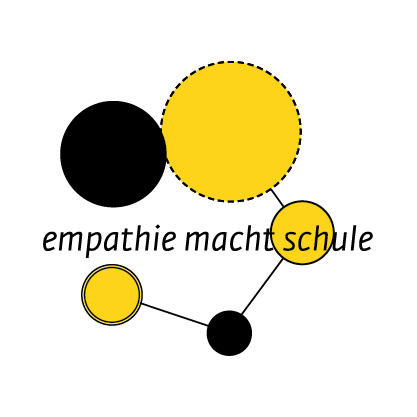Am 10. Januar bin ich auf Zeit von zu Hause ausgezogen, um ein Sachbuch termingerecht beim Verlag abzugeben. Mein Mann war zwischen zwei Arbeitsaufenthalten im Ausland (er ist Kameramann) sechs Wochen am Stück zuhause, und wir hatten abgemacht, dass er den familiären Alltag übernimmt. Ich freute mich schon seit Wochen auf diesen Freilauf für meine Kreativität: Die einzigen Verpflichtungen, die ich hatte, waren meine Arbeit, mir etwas zu Essen zu machen, zu trinken und zu schlafen. In den Pausen genoss ich es, mich kurze Zeit im Strom der Menschen treiben zu lassen.
Dann kamen die Corona-Beschränkungen. Obwohl sich im Außen für mich faktisch wenig änderte – ich war ja vorher schon allein und sozial zurückgezogen – änderte sich in mir alles. Vorher hatte ich mich mit meinem Buchvorhaben richtig gefühlt (es geht darum, wie Familien die Empathiefähigkeit ihrer Kinder stärken können). Jetzt fühlte sich meine Arbeit mit einem Mal nicht mehr „notwendig“ an, ja, die ganze Situation erschien mir falsch. Ich schämte mich, als ich mit meinen jugendlichen Kindern sprach und ihnen sagte, dass ich doch noch länger von der Familie getrennt an meinem Buch arbeiten würde (Filmarbeiten waren weltweit eingestellt und ihr Vater bis auf unbestimmte Zeit vor Ort, eigentlich ein Glücksfall). In mir stieg eine Unruhe auf, die ich so nicht kannte. Ich machte Atemübungen, Meditationen, Schreibübungen, Yoga, Spaziergänge um den Block, kochte, machte alles, was mich sonst ablenkt, nur: nichts half. Ich kam mir vor wie ein Tiger im Käfig.
Wenn ich mich schäme, wird mir schlecht. Ich habe, wie der Volksmund es sagt, einen Stein im Magen liegen. Oder eine geballte Faust. Wenn ich mich schäme, helfen Ablenkungen nicht. Jedes Mal, wenn ich meine Aufmerksamkeit wieder auf meinen Magen lenke, ist der Stein, die Faust noch da. Obendrauf bekam ich auch noch eine Schreibblockade. Und mit jeder Zeile, die nicht geschrieben wurde wuchs das schlechte Gewissen. Ich wollte zurück zu meinen Kindern, oder wenigstens Ärztin, Krankenschwester, Kassiererin, Müllfrau sein, weil mir schien, dass es dann wenigstens Sinn machte, in der Krise nicht zu Hause zu sein.
Das änderte sich erst, als ich einer befreundeten Ärztin gestand, dass ich mit ihr tauschen wolle, denn sie gab mir zur Antwort: „Von wegen, ich möchte auch so gerne bei meinen Kindern zu Hause sein, muss aber wie immer morgens früh um 6 Uhr schon aus dem Haus. Ich hoffe, wie du, dass ich sie dennoch so gut wie möglich begleiten kann.“ Ich fühlte mich besser, weil ich damit nicht allein war. Die Scham aber blieb.
Scham ist ein so unangenehmes Gefühl, dass man sich sogar schämt, sich zu schämen. Und Scham ist, dachte ich, genau deshalb dazu prädestiniert, ganz tief in den Kanälen der Verdrängung zu verschwinden. Als ich mich diesen Gedanken freundlich zugewendet habe, wurde ich ruhiger. Ich nahm ein warmes Bad, machte mir einen Kamillentee, so, wie es meine Großmutter früher für mich gemacht hatte – und erinnerte ihre freundlichen Worte dazu: „This, too, shall pass“ – auch das wird vergehen. Wie übrigens auch die Scham darüber, dass es mir an manchen Tagen schwer fällt, mich mir selbst so freundlich zuzuwenden.

Mona Kino
Drehbuchautorin, Familientherapeutin und Supervisorin
Vermittlungs- und Presseteam bei Empathie macht Schule
Titelphoto von congerdesign auf Pixabay